Monat: November 2015
-

Ei-enn-di-ssie
Der einzige Erfolg, den die internationale Gemeinschaft bei ihren Verhandlungen bisher erzielt hat, ist die sogenannte Zwei-Grad-Grenze (und es ist eine Grenze, kein Ziel). Im mexikanischen Cancún, im Jahr 2010, haben die Staaten beschlossen, dass eine Erwärmung bis 2100 gegenüber der vorindustriellen Zeit um diesen Wert gefährlichen Klimawandel darstellt. Und am Anfang des ganzen Prozesses,…
-
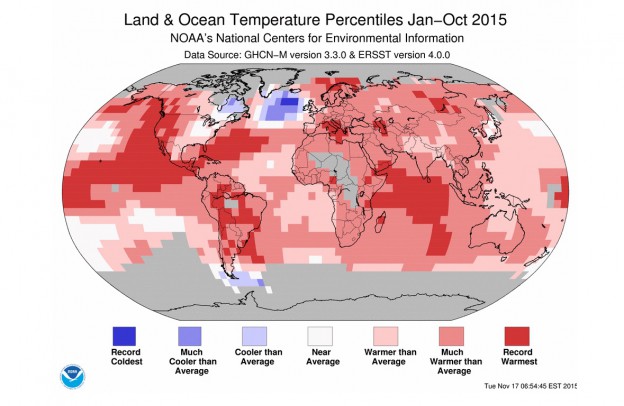
Welche Pause?
„Seepage“, das ist im Englischen ein technischer und geologischer Begriff, der etwas mit Ein- oder Durchsickern zu tun hat. Je nach den beteiligten Flüssigkeiten kann der Vorgang einigermaßen unappetitlich werden, und es ist anzunehmen, dass diese Assoziation Stephan Lewandowsky und Naomi Oreskes ganz willkommen war. Sie haben den Begriff nämlich ins Feld der Wissenschaftsgeschichte übertragen.…
-

Der Klimawandel ist da, da und da
Bis vor kurzem haben Klimaforscher diese Frage gehasst: „Ist das schon der Klimawandel?“ Wenn Wälder brannten, Städte glühten, Felder vertrockneten oder anschwellende Flüsse Dörfer versenkten, dann rief bestimmt jemand an und wollte das wissen. Und meist war dann die Antwort: Es ist unmöglich, für ein einzelnes Extremereignis genau anzugeben, was es ausgelöst hat – oder…
-

Wo das Meereis bleibt
Auf Spitzbergen hat der Klimawandel kurz der Jahrtausendwende richtig angefangen. Der Osten der Inselgruppe war bis dahin fest im Griff des Meereises. Wenn es dort 15 eisfreie Tage im Jahr gab, war das schon eine Ausnahme; mehr als 50 kamen praktisch nicht vor. Das begann sich in den späten 1990er-Jahren zu ändern: Der Trend der…